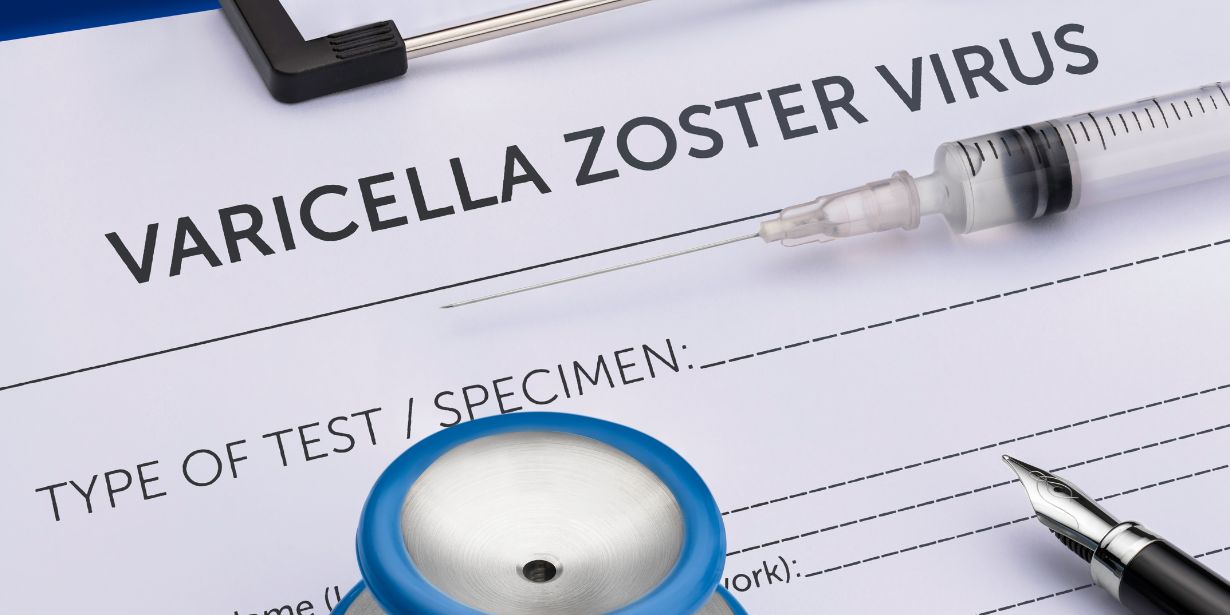Bei einer Gürtelrose kommt es zu Hautrötungen, die oft am Bauch wie ein „Gürtel“ um den Körper verteilt sind. Die Rötungen hat man früher als „Rose“ bezeichnet.

- Die Gürtelrose kann zudem an Armen und Beinen vorkommen. Ebenfalls betroffen können das Gesicht mit den Augen sowie Ohren und Gesichtsnerv sein.
- Zu der Hautrötung hinzu kommen juckende und schmerzende Knötchen, die sich zu flüssigkeitsgefüllten Bläschen entwickeln. Die Bläschen verkrusten und heilen dann ab. Dabei kommt es zu Wundschmerz.
- In einigen Fällen kommt es auch zu einer Gürtelrose ohne Ausschlag und Bläschen (Zoster sine herpete). Die Symptome bestehen dann nur aus Schmerzen in einem umgrenzten Bereich der Haut und Sensibilitätsstörungen.
Gürtelrose an den Augen
Bei etwa 10 bis 20 Prozent der Betroffenen betrifft die Gürtelrose die Augen (Zoster ophthalmicus).

- Es kommt dann zu Hautveränderungen im Bereich der Nase und, manchmal erst nach einigen Wochen, zu Entzündungen der Hornhaut, Bindehaut oder Netzhaut.
- Gürtelrose an den Augen kann zu bleibenden Schäden an den Augen führen.
- In schweren Fällen führt die Erkrankung zur Erblindung. Wegen der möglicherweise schweren Folgen ist eine frühzeitige augenärztliche Mitbehandlung wichtig.
Ohren und Gesichtsnerv betroffen
Von der Erkrankung kann auch das Ohr betroffen sein (Zoster oticus).

- Es kann zu Ohrenschmerzen, Hörminderung und Schwindel kommen.
- Auch eine Lähmung des Gesichtsnervs (Facialisparese) auf der betroffenen Seite ist möglich. Die Hautveränderungen befinden sich an der Ohrmuschel oder im Gehörgang und sind manchmal von außen nicht zu erkennen.
- Eine Sonderform dieser Art der Gürtelrose ist das Ramsay-Hunt-Syndrom. Hierbei kommt es zusätzlich zu einer Gesichtslähmung auf der betroffenen Seite.
Wie alle Formen der Gürtelrose kann auch der Zoster oticus zu bleibenden Schäden führen, weshalb eine frühzeitige Mitbehandlung durch den HNO-Arzt und den Neurologen wichtig sind.
Befall des ganzen Körpers und Organentzündungen
Bei schwerer Einschränkung des Immunsystems kann es in seltenen Fällen statt eines lokalisierten Ausbruchs zu einer Beteiligung des gesamten Körpers kommen (Zoster disseminatus). Hierbei können Organe befallen und beschädigt werden. Bei schweren Verläufen kann es zum Multiorganversagen kommen.
Nervensystem betroffen

Die Erkrankung kann, besonders bei Beteiligung des Kopfes, in seltenen Fällen auch das Nervensystem einbeziehen. Zwar verläuft diese Infektion oft ohne Symptome, es kann aber auch zu Entzündungen von Hirn-, Hirnhäuten, Rückenmark oder Gefäßen kommen, die zu schweren neurologischen Symptomen führen können.
Die Gefäßbeteiligung kann das Schlaganfallrisiko erhöhen. Besonders bei älteren Patienten oder Menschen mit Immunschwäche sollte frühzeitig eine neurologische Untersuchung erfolgen.
Andere neurologische Erkrankungen
Außerdem kann die Krankheit andere neurologische Erkrankungen wie eine Gehirnentzündung (Enzephalitis), Rückenmarksentzündung (Myelitis) und Nervenwurzelentzündung (Radikulitis) auslösen.